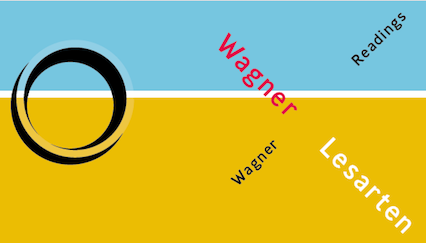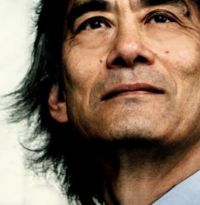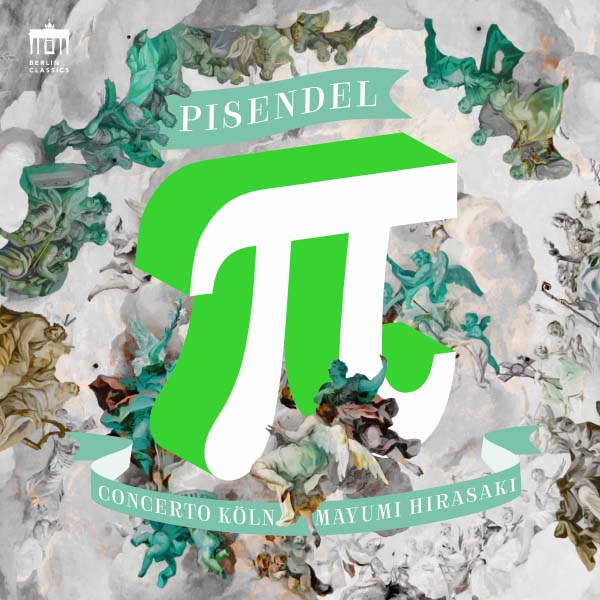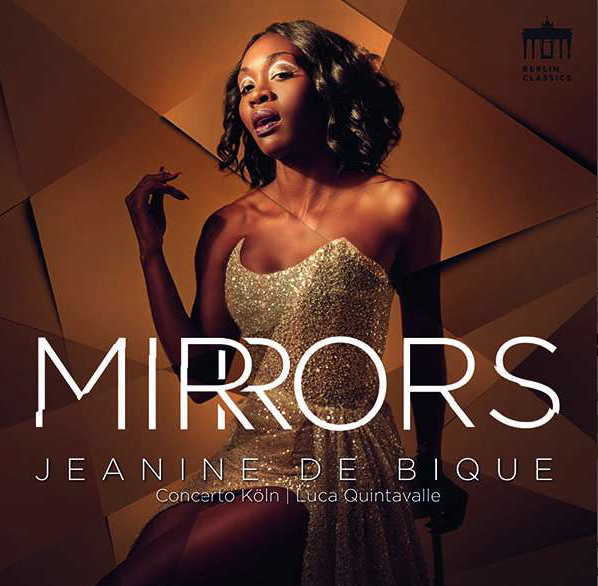Have any questions?
+44 1234 567 890
Workshop Romanticism
The workshop week “Historical Performance Practice of the 19th Century – Romanticism” promises to be a comprehensive guide to European music in the 19th Century.
With Jakob Lehmann, Shunske Sato, Kinnon Church and Clive Brown.